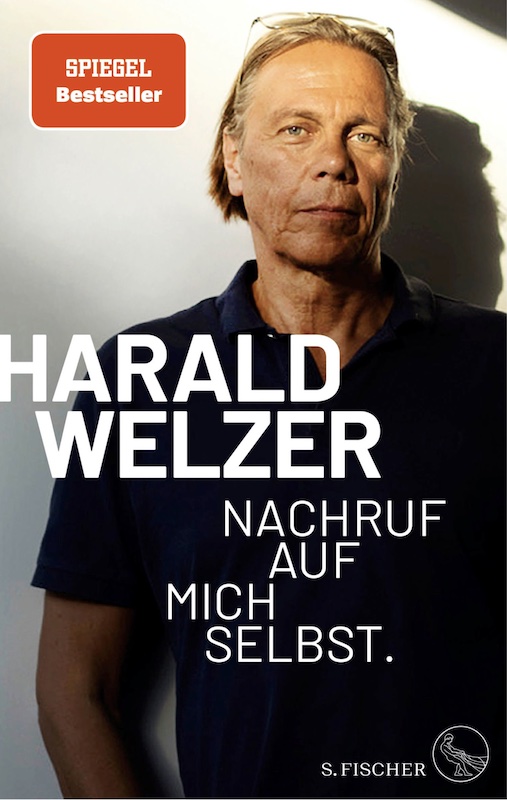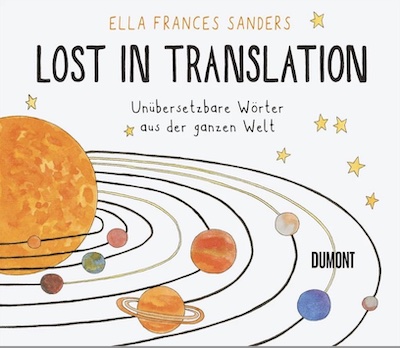K-Kulturexplosion
Bereits seit den 1990er Jahren ist Korea popkulturell auf dem Vormarsch. „K-Culture“ oder die „Koreanische Welle“ ist seitdem in die globale Kulturszene geschwappt und hat in den letzten Jahren – vor allem wegen der Vernetzung sozialer Medien – zunehmend Fahrt aufgenommen und an Bedeutung gewonnen; im Mainstream vor allem im Bereich Musik (Gangnam Style) und Film (Squid Game). Was ist der K-Style, der mittlerweile alle Kulturräume abdeckt: Kunst, Design, Fashion, Kosmetik, Tatoos, Food, Foto, Industriedesign, Architektur und Interieurarchitektur? Was zeichnet ihn aus? Dieser Frage geht dieses Buch nach und zwar aus der Sicht der Protagonisten der Szene in Seoul.
„Die Anfänge des K-Pop sind älter als die sozialen Medien. Vielleicht sogar älter als das Internet.“

K-Pop, K-Style: Music, Art & Fashion aus Südkorea
von Fiona Bae
aus dem Englischen von DR. Cornelia Panzacchi
Fotografien: less_TAEKYUN KIM
Originaltitel: Make Break Remix. The Rise of K-Style
Edel Books, 2022
Gebunden, 304 Seiten
ISBN 978-3841908193
15,0 x 2,8 x 21,8 cm
EUR 26,-
Das mehr als 300 Seiten starke Buch hat ein halbes Duzend Bildstrecken auf Kunstdruckpapier mit Fotos vom Szenefotografen less_TAEKYUN KIM, der die Stimmungen, rund um das aktuelle Kulturgeschehen in Seoul wunderbar eingefangen hat. Dazwischen gibt es ausführliche Interviews mit tonangebenden Akteuren der K-Culture, die teilweise bereits seit Jahrzehnten dabei sind und die Entwicklungen stark beeinflusst haben. Der Fokus wird dabei auf die Keimzellen der Kultur – die Untergrundszene gesetzt.
„Der K-Style mixt alles Coole mit einer gewissen Dynamik. Das erregt sofortige Aufmerksamkeit.“
Sobald etwas im Mainstream angekommen ist, muss es einen neuen Dreh geben, der für Aufmerksamkeit sorgt. Daraus entstehen zyklische Prozesse der Erneuerung. Es geht darum Grenzen auszutesten. Viele der Akteure sind Autodidakten, die innerhalb der Community ihr Selbstverständnis entwickeln. Korea hat ausgeprägte handwerkliche Traditionen, die gepaart mit der Intuition des Schamanismus und den Werten des Konfuzianismus zu – für westliche Augen – ungewöhnlichen Lösungen führen.
„In der Vergangenheit standen wir vor den Endergebnissen, ohne etwas über den Schaffensprozess zu wissen.“
Um zu verstehen, warum ausgerechnet in diesem kleinen Land, das zwischen China und Japan eingezwängt ist und erst seit 1988 eine Demokratie bekommen hat, eine solche Kulturexplosion stattfindet, muss man die geschichtlichen und kulturellen Hintergründe, aber auch die aktuellen politischen Strategien betrachten. Seit dem globalen Erfolg der K-Culture wird die gesamte Kulturszene mit einem staatlichen Budget in der Größenordnung von 1% des GNP gefördert. Diese Tatsache allerdings, wird in dem Buch nicht erwähnt.
„Die Leute ahmen ständig nach und entfernen sich so immer weiter von Originalität und kreativer Identität.“
Die meisten der koreanischen Akteure haben ihre Wurzeln im Ausland, dort studiert oder gelebt. Die Verbindungen zu den USA und Japan sind dabei am stärksten. Die koreanische Gesellschaft ist sehr traditionell und homogen und wird durch die K-Culture stark herausgefordert. Allerdings führt genau diese Reibung zu der Innovation, die hier täglich stattfindet. Die Szene der Kulturschaffenden ist trotz ihrer Schnelllebigkeit und vermeintlichen Oberflächlichkeit sehr stabil und wird von großer Solidarität getragen.
„Viele Idole haben eine gewisse Wirkung. Jedes Produkt, mit dem sie gesehen werden, ob es Chips oder Papiertaschentücher sind, verkauft sich wie von selbst.“
Die Autorin Fiona Bae ist in Korea aufgewachsen, hat dort an der Yonsei-Universität studiert, lebt und arbeitet seitdem überall auf der Welt und wirbt leidenschaftlich für die Kultur ihres Landes. Nach Stationen in New York und Hongkong lebt die PR-Beraterin derzeit in London, von wo aus sie kulturelle Brücken zwischen Korea und dem Rest der Welt schlägt. Sie organisiert internationale Events und berichtet in der englischsprachigen Presse über das Stadtleben und die Design- und Kunstszene von Seoul.
„Die koreanischen Modemarken müssen heute nicht einfach nur Kleidungsstile herstellen, sondern außerdem laufend neue Modelle anbieten, um als Marke direkt mit dem Kunden zu kommunizieren.“
Die deutsche Ausgabe des Buchs ist bei Edel Books erstaunlicherweise einige Wochen vor der englischen Originalversion „Make Break Remix. The Rise of K-Style“ (erscheint am 22. November 2022 bei Thames & Hudson) herausgegeben worden. Dass das Original von der Koreanerin Fiona Bae auf Englisch verfasst, und dann ins Deutsche übertragen wurde, merkt man dem Text durchaus an. Er wirkt recht glatt und nüchtern, oft unemotional abgespult, ohne jegliche sprachliche Finesse, was jedoch der Authentizität der Interviews nicht schadet. Als Satzschrift wurde eine sehr schlichte Grotesk gewählt, die gut lesbar ist, jedoch durch ein unproportional gestaltetes „ß“ auffällt.
„Beim K-Style geht es darum, der eigenen Stimme Ausdruck zu verleihen.“
Mir hat das Buch so gut gefallen, dass ich es ganz fasziniert an einem Tag durchgelesen habe. Zu Intensiverung der Stimmung habe ich dabei eine Playlist des aktuellen K-Pop gehört. Als Designer bin ich weder besonders musikaffin noch habe ich sublime Kenntnis der koreanischen Kultur, bekomme jedoch durch dieses Buch einen kleinen Einblick in die Kulturexplosion Koreas, den ich mit Sicherheit vertiefen werde. Eine Reise nach Seoul steht in den kommenden Jahren an …
Buch bei Hugendubel bestellen:
https://www.hugendubel.de/de/buch_gebunden/fiona_bae-k_pop_k_style-42432362-produkt-details.html