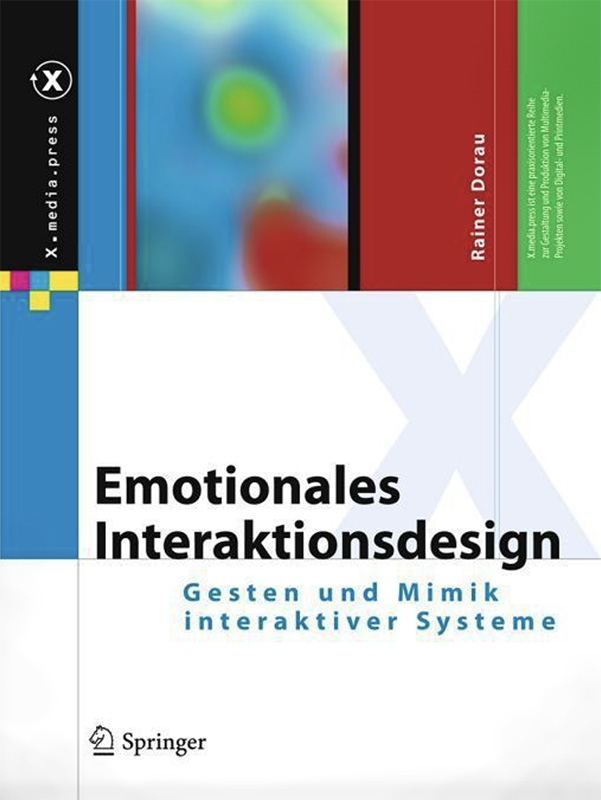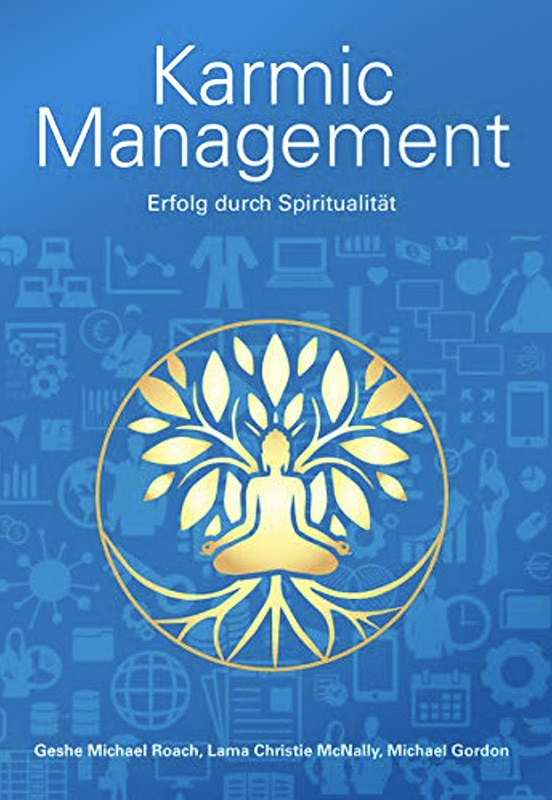Kann schlechtes Gewissen töten?
Andere Rezensenten haben sich auf Schilderung von Handlung und Personen konzentriert. Ich möchte einen Blick auf die eher weichen Faktoren dieses Meisterwerks werfen. Es ist einige Zeit seit der letzten Lektüre eines Murakami vergangen.
Doch mit „Die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tazaki“ liegt wieder ein großartiges Buch vor uns – auch wenn „Kafka am Strand“, das ich sowohl in der deutschen als auch in der englischen Fassung gelesen habe, mir nach wie vor als sein bemerkenswertestes Werk erscheint.

Die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tazaki
von Haruki Murakami
ins Deutsche von Ursula Gräfe
DuMont, 2014
Gebunden, 318 Seiten
ISBN 978-3832197483
Originaltitel: Shikisaki wo motanai Tazaki Tsukuru to kare no junrei no toshi
14,2 x 3,5 x 21,6 cm
Der Einband mit dem transparenten Schutzumschlag ist alles andere als farblos und deutet grafisch die Farbensymbolik der Geschichte an. Sehr praktisch und wertig auch das leuchtend rote Lesebändchen. In Zeiten digitaler Bücher spielt der bibliophile Charakter von Hardcover-Büchern eine zunehmend wichtigere Rolle.
Wie immer bei Dumont sind Typografie und Papier optimal auf einander abgestimmt. Im Gegensatz zu den Einbänden der IQ84-Trilogie bleibt das Buch – einmal aufgeschlagen – jedoch nicht offen liegen.
Wie kaum ein anderer beherrscht Murakami die Kunst, den Leser absolut mit der Handlung zu verschmelzen; als würde der Leser das Buch selbst schreiben, während er es liest! Man hat das Gefühl, dass alle seine Bücher in den gleichen Landschaften spielen.
Die Personen scheinen miteinander verwandt und sind in ihren Wesenszügen so klar und reduziert, dass einem die sonst eher fremden Japaner hier sonderbar vertraut vorkommen. Ebenso geht es dem Protagonisten, der sich auf seiner ersten Auslandreise in Helsinki zwar einsam – aber nicht fremd fühlt.
Während frühere Bücher häufig in zeitlosen Räumen des vergangenen Jahrhunderts spielen, so ist diese Handlung fest in unsere Jetzt-Zeit gesetzt. Ein bei Murakami auffälliges Stilmittel hierfür, ist die unverblühmte Nennung von Markennamen wie Facebook, Lexus, Marlboro, TAG Heuer.
Wiederkehrendes Stilelement ist auch die Inszenierung vordergründig unbedeutsamer, spekulativer und bizarrer Gegebenheiten – wie in diesem Buch der sechste Finger, der im Laufe der Geschichte zu einem mystischen Hintergrundmotiv aufgeladen wird.
Auch die Verwendung seltener Worte und Fremdworte ist ihm lieb: „Diese Möglichkeit schwebte wie eine feste, kleine Lenticulariswolke ständig über ihnen.“ Erst ein Blick in Wikipedia gibt Aufschluss: eine Wolke in Linsenform, die an ein außerirdisches Raumschiff erinnert.
Und wer hat Beiläufigkeit besser so konzis inszeniert: „Sara nahm einen Schuck von ihrem Mojito und inspizierte die Form des Minzblatts von allen Seiten.“
Synästhesie, das Zusammenklingen und Überlagern verschiedener Sinneseindrücke um Stimmungen zu erzeugen, ist wohl sein wichtigstes Stilmittel. Meist benutzt er dafür Musik, hier das Thema „La Mal du Pays“ aus den Années de Pèlerinage von Franz Liszt. Die wiederkehrenden Erinnerungen daran legen einen Schleier grundloser Trauigkeit über die Handlung.
Und immer wieder das Spiel mit der fast nicht wahrnehmbaren feinen Linie, die das Realistische vom Phantastischen trennt: „Er hatte gelebt wie ein Schlafwandler … wie jemand, der von einem Orkan überfallen wird, sich von einer Straßenlaterne zur nächsten hangelt.“
„Er hing gerade noch an der Welt wie die trockene Hülle eines Insekts, die an einem Ast schaukelt und kurz davor ist, vom nächsten Windstoß für immer davon geweht zu werden.“ Ständig grenzüberschreitend, Assoziationen auslösend, abschweifend jedoch immer wieder in den Alltag zurückkehrend: “ … und stupste mit einer sanften Geste, die an die weiche Nase eines großen Hundes denken ließ, eine Taste des Haustelefons an.“
Oder wenn seine Gedanken sich nächtens im Kreise drehen und er immer wieder an den Ausgangspunkt zurückkehrt: „Es war wie bei einem Schraubenkopf ohne Schlitz – er wußte nicht mehr, wo er noch ansetzen sollte.“
Den wie gelähmten Zustand zwischen Träumen und Wachen, kann kein anderer so gut beschreiben wie Murakami: „Er konnte weder seine Lippen noch seine Zunge bewegen. Nur lautloser, trockener Atem entströmte seiner Kehle.“
Wenn es in dem Buch Längen geben sollte, sind diese so gut bemessen, dass genau in dem Moment, wo man sie wahr nimmt, wieder ein spannendes Element auf der Bühne erscheint. Beim Lesen wird Bewußtheit erzeugt – oft durch das Dehnen und Zusammenziehen von Zeitempfindung.
Das Buch lebt von dem Faszinosum der Versenkung; lebt von der Suche nach Erkenntnis und endgültigen Wahrheiten in philosophischen Dialogen: „Die Freiheit des Denkens kann man nicht erreichen, wenn man willentlich danach strebt.“
Manchmal ahnt man eine Verwandschaft zu Hermann Hesses „Glasperlenspiel“: die Bewunderung der Perfektion des Geistes und die Ohnmacht und Zerissenheit gegenüber der Unvollkommenheit und Hinfälligkeit des Körpers.
Vermutlich ist auch in diesem Buch viel Autobiografisches eingearbeitet. Es geht um die metaphysischen Transformationen menschlicher Existenzen, die mit unsichtbaren Schicksalsfäden aneinander gebunden scheinen: Verhaftung überwinden, loslassen, überleben …
Es geht um Schuldigkeit, Todessehnsüchte und Identitätsverlust… Kann schlechtes Gewissen töten? Es geht um die Sinnhaftigkeit des Lebens, darum für andere bedeutsam zu sein.
Ein Leitmotiv des Buchs ist unterdrückte Sexualität und die Angst von deren Auswüchsen, die scheinbar immer unterhalb der Oberfläche lauern.
Im letzten Kapitel werden alle Geschenisse noch einmal kontemplativ zusammengefasst:
„Es ist schon seltsam … dass diese wunderbare Zeit vorbei ist und niemals wieder so sein wird. Dass der Fluss der Zeit all unsere fabelhaften Möglichkeiten mit sich fortgetragen hat und sie nun verschwunden sind.“
Das Ende ist diffus optimistisch, fast heiter – aber auch melancholisch, immer mit der Melodie des Themas von „La Mal du Pays“ im Ohr …